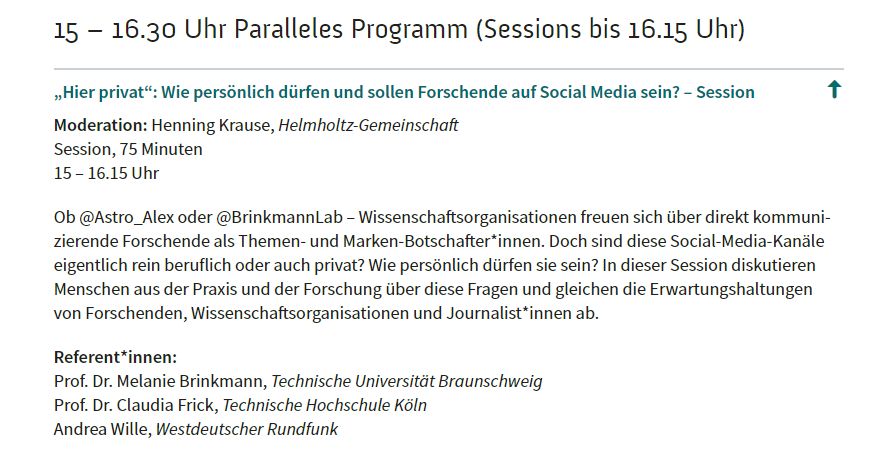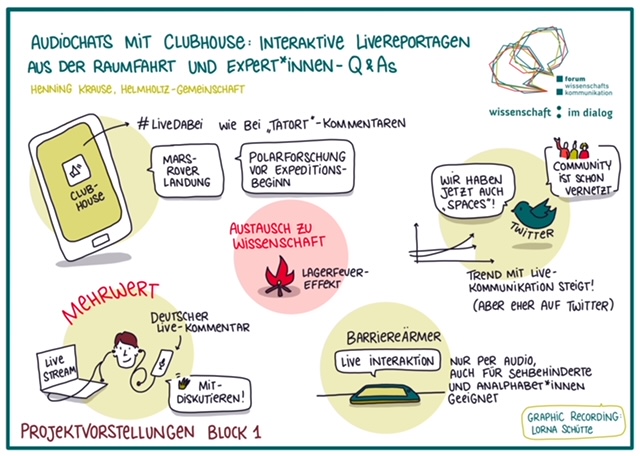Es waren dies (bis letzten Herbst) eine Reihe schöner Jahre seit 2009, die jetzt zuende gehen. Im Folgen spreche ich über meine persönliche Social Media-Kommunikation, nicht über die in meinem beruflichen Umfeld. Ich begründe darin, warum ich nun nach etwa 15 Jahren meinen persönlichen X-Account (zuvor: Twitter) lösche.

Am 6.11.2022 legte ich meinen Account still. Aber das reicht nicht. Die Plattform ist so toxisch und demokratiegefährdend geworden, dass ich die Existenz des Accounts nicht mehr rechtfertigen kann. Ich möchte die schnelle Entwicklung dahin in den 11 Monaten seit der (damals noch) Twitter-Übernahme durch Elon Musk hier nochmal zusammenfassen. Es wird immer deutlicher, dass Elon Musk nie vorhatte, den Dienst als globalen Chat weiter zu betreiben. Seine Funktion als gesellschaftliche Kommunikationsinfrastruktur hat die Plattform durch die massiven Änderungen der vergangenen Monaten bereits eingebüßt.
Auch zur Erinnerung an uns selbst, dass vom alten Dienst und der alten Community der Jahre 2009 bis 2022 nicht mehr viel übriggeblieben ist, sollten wir wirklich nicht mehr von „Twitter“ sprechen.
Was war passiert?
- Herbst 2022: „Let that sink in“ – Elon Musk spaziert nach der Akquise mit einem Waschbecken ins Twitter-Hauptquartier. Von den Massenentlassungen bei Twitter (6.000 von 8.000 Personen) sind insbesondere Moderationsteams betroffen, die zuvor noch Falschnachrichten und Hassrede entfernt hatten.
- Dezember 2022: Bezahlprogramm „Twitter Blue“ (später: „X Premium“) gestartet. Damit wurde den meisten Organisationen, die eine blauen Haken hatten („legacy verified“) der Haken entzogen. Später wurde Bezahlaccounts Sonderrechte und höhere Sichtbarkeit eingeräumt. Für Organisationen soll der Bezahldienst 1.130 Euro pro Monat netto kosten.
- Dezember 2022: Mein berufliches Baby als Antwort auf den Musk-Kauf geht live: Helmholtz launcht Mastodon-Server für institutionelle Accounts der Gemeinschaft.
- Januar 2023: Abschalten der 3rd party apps, die bislang noch einen chronologischen Feed ohne Werbeeinblendungen ermöglicht hatten.
- Februar 2023: Abklemmen der kostenlosen Twitter-Programmierschnittstelle („API“). Das kleine Paket für die Analysemöglichkeit (Zugriff auf 3% der Postings) liegt bei 42.000 US-$ pro Monat. Jahrelange kommunikationswissenschaftliche Forschung mit Voll-Zugriff wird damit ersatzlos unmöglich gemacht. (Quelle)
- Februar 2023: Twitter zahlt keine Büromiete und Serverkosten mehr bei Amazon Web Services. Technische Ausfälle häufen sich. (Quelle)
- März 2023: Meta nutzt die Schwäche von Twitter und kündigt den Konkurrenten Threads an. (Quelle) Twitter-beantwortet alle Mails an die Pressestelle-Mailadresse per Autoresponder mit einem Kackehaufen-Emoji. So geht man in einer Demokratie nicht mit der vierten Gewalt um.
- März 2023: Twitter verschiebt die bisherige „Timeline“ (= Tweets meiner Follows plus gelegentliche Einstreuungen von Werbung und Algorithmus) auf einen zweiten Tab. Neue Home-Ansicht ist die ausschließlich algorithmisch gesteuerte „For you“-Page, in die man als Contentanbieter eigentlich nur noch mit sponsored Content hinein kommt. Tweetdeck wird als bislang mächtigstes Kommunikationsmanagement-Tool weitestgehend beschnitten und wandert im Juli 2023 komplett hinter die Paywall.
- April 2023: Twitter kennzeichnet NPR und PBS als „government controlled“ und „state funded“. Erstes deutsches Medium (Verlagsgruppe Rhein-Main) verlässt Twitter. Twitter Inc. umbenannt in X Inc.
- April 2023: Bei der Offenlegung des Twitter-Algorithmus‘ werden Code-Teile öffentlich bekannt, die eine algorithmische Bevorzugung der Tweets des persönlichen Accounts von Elon Musk um den Faktor 1000 beinhalten.
- Mai 2023: Elon Musk teilt antisemitische Verschwörungserzählungen bezüglich George Soros. Berufliche Empfehlung für ein Twitter-Moratorium aus Brand Safety-Gründen.
- Mai 2023: Laut Untersuchungen ist Twitter im englischsprachigen Raum zu einem politischen rechtsaußen-Netzwerk geworden. (Quelle) Twitter tritt aus europäischem Pakt gegen Desinformation aus. (Quelle)
- Juni 2023: Eine Auswertung von über einer Milliarde deutschsprachiger Tweets aus den letzten Monaten vor und nach der Musk-Übernahme zeigt eine statistisch signifikante Änderung der Inhalte weg von einem zuvor breiteren Diskurs hin zu rechtsextremen Inhalten, Verschwörungserzählungen und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit mit viel mehr Hassrede. Twitter ist auch im deutschsprachigen Raum zunehmend zu einer Nazi- und Trollmaschine geworden. (Quelle)
- Juli 2023: Am ersten Juli-Wochenende kam es zu massiven technischen Ausfällen. Adhoc-Einführung von Lese-Limits von 600 Tweets/Tag für nichtzahlende Accounts; 6000 für Bezahlaccounts. Dies mache Journalist:innen Recherchen im Rahmen von Nachrichtenlagen unmöglich, so Expert:innen. Temporär werden Tweets nichteingeloggten Usern gar nicht mehr angezeigt.
- Juli 2023: Umbenennung zu X. Musk fordert Meta-CEO und Threads-Betreiber Mark Zuckerberg zu einem Cage-Fight heraus, am 10. Juli 2023 ergänzt er: „I propose a literal dick measuring contest 📏“
- August 2023: Nature-Studie: Forscher:innen ziehen sich von Twitter zurück; 46% der kommunizierenden Forschenden sind lauf Umfrage bereits zu anderen Diensten gewechselt. (Quelle) X baut temporär beim Aufrufen von Links zu liberalen Medien wie NYT und Konkurrenzdiensten technische Ladeverzögerungen von zweieinhalb Sekunden ein. (Quelle)
- September 2023: Elon Musk macht jüdische Organisation für Einnahmeverluste verantwortlich. (Quelle) Bei einer Vergleichsanalyse zur Bekämpfung von Klima-Desinformationen schneidet X am schlechtesten ab. (Quelle)
- Am 26.09.2023 wurde ein EU-Bericht (Newsguard) zu Missinformation in Social Media veröffentlicht. Fazit: Bei X ist es am schlimmsten. (Quelle) EU-Kommissarin Věra Jourová sagte bei der Vorstellung in Bezug auf X: „The Russian state has engaged in the war of ideas to pollute our information space with half truth and lies to create a false image that democracy is no better than autocracy“ … und weiter: „disinformation actors were found to have significantly more followers than their non-disinformation counterparts and tend to have joined the platform more recently than non-disinformation users.„
Und nun?
Die Umbenennung hin zu X zeigt: Wer eine so starke Marke aufgibt, hat nicht vor, den Dienst als Kommunikationsplattform zu erhalten. Die monatelange Aufmerksamkeitshype-Welle im Trumpschen Ausmaß („flood the zone with shit“) zeigt, dass die 44 Mrd-Dollar-Investition nur dem Aufbau der Musk‘schen Vision der „everything app“ dient. Das belegen Vorbereitungen, Bezahl-, Anruf- und Videochat-Funktionalitäten in der X-App zu ergänzen. Es ging dabei nie um unsere aktive Twitter-Community. Es gibt kein Twitter mehr. Wir sollten nicht so tun, als sei daran festzuhalten, unsererseits dasselbe Verhalten wie vor einem Jahr. X wird mittelfristig kein Kommunikationsdienst bleiben.
Gleichzeitig machen verschiedene User ganz unterschiedliche Erfahrungen bezüglich einer Veränderung der Reichweite und Interaktion auf Twitter. Manche erreichen dort zwar weniger, aber noch ausreichend viele User. Andere berichteten, dass die Reichweite auf X weitestgehend weg sei. Ich sehe ein massives Verstummen progressiver Stimmen z.B. im Klima-Diskurs (vgl. Reaktionen auf aktuellen Tweet von KIT-Forscher Christian Scharun) und eine überwiegende Reaktionen durch wissenschaftsfeindliche, rechtsextreme und Verschwörungsaccounts. Hier erscheint eine faktenorientierte Gegenrede als reine Zeitverschwendung beschränkter Personalressourcen. Es ist ein bisschen so, als würden wir versuchen, die Welt durch Leserbriefe im „Stürmer“ zu retten, sagte mir ein geschichtsbewusster Forscher kürzlich.
Eine kommentarlose Weiternutzung dieses neuen Dienstes X, der kaum noch etwas gegen Hassrede, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus, Wissenschaftsfeindlichkeit und Falschmeldungen tut, wäre auch eine aktive Entscheidung und eine Botschaft auf der kommunikativen Metaebene.
Meine Folgerung daraus ist, dass ich meinen X-Account zum 01.10.2023 lösche. Ich habe mir ein Archiv meiner alten Tweets runter geladen und danach alle Tweets als gelöscht markiert. Es mag schade erscheinen um 4.100 gesammelte Follower, aber die Reichweite einzelner Postings lag zuletzt eh nur noch im mittleren dreistelligen Bereich. Das einzige, worum es echt schade ist und was ich nicht exportieren konnte, ist meine über Jahre hinweg äußerst liebevoll gepflegte Blockliste mit 3083 stummgeschalteten (Werbe-)Accounts und 1415 blockierten Konten.
Aber die Reichweite
Mit unseren Inhalten auf X unterstützen wir auch einen Dienst, der gerade immer mehr demokratiegefährdende Merkmale einer Diskursplattform entwickelt. Wir sind Zeitzeugen dieser Entwicklung in den vergangenen 11 Monaten. Auf einer neuen Plattform mit solchen Eigenschaften würden wir uns heute nicht neu registrieren. Unter dieser Vorbemerkung sollten wir auch über Reichweite-Argumente nachdenken.
Einige erzielen weiterhin noch Reichweite auf X. Angesichts von bis zu 15 Jahren gesammelter Followings mit teilweise uralten Karteileichen-Accounts müssen wir Alt-Account-Betreibenden uns aber auch ehrlich machen: X ist ein Scheinriese, wenn man nur auf die Followerzahlen guckt. Und Alternativen wie Mastodon erzielen bereits jetzt bei einigen Akteur:innen bessere Interaktionsraten. Die Tagesschau ist nach vier Monaten zufrieden mit Ihrem Mastodon-Start: „Gutes Wachstum. Besseres Klima als auf X, eher Auenland als Mordor. Mehr Interaktionen pro Post, Conversion/Klicks in Relation 4x so gut.“ (Quelle)
Alternativen
In meinem Essay zur Open Social Infrastructure habe ich 2018 versucht zu begründen, warum wir den oben für den Dienst X beschriebenen Problemen wohl nur mittels dezentraler Kommunikationsinfrastrukturen entkommen können. Wir können und sollten gleichwohl neue zentrale Dienste wie Threads von Meta bzw. halboffene Systeme wie Bluesky mit beobachten, die Alternativen darstellen können. Einen positiven gesellschaftlichen Diskurs auch zum Thema Wissenschaft voranzutreiben, lohnt sich aber nach meiner Analyse insbesondere auf dezentralen (Fediverse-) Diensten wie Mastodon. Es existieren bereits zahlreiche Mastodon-Server. Wissenschaftler:innen können z.B. auf die Mastodon-Instanz fediscience.org einen Account einrichten, hier gibt es schon mehr als 2.000 Profile. Lasst uns da weiter machen!
Too long; didn’t read
TL;DR: Twitter ist tot. Wir hatten ein paar gute Jahre dort. Unsere ehemals interessierte Twitter-Community ist größtenteils nicht mehr bei X. X wird umgebaut zu etwas, das kein globaler Chat mehr sein wird. Ein „weiter so“ auf X bedroht die Brand Safety von Marken. Es gibt gute, allerdings noch reichweitenärmere Alternativen. Für mich ist Mastodon ein guter Ersatz.
Further viewing/listening/reading: ZDF Magazin royale vom 2.06.2023 und zum Hören „den Vogel abgeschossen“-Podcast (6 Teile). Wenn man nur einen Text zum Thema lesen will, dann diesen. Props und starke Podcast-Hörempfehlung: Haken dran. Danke Dennis, danke Gavin für die Trauerarbeitsbegleitung!
Updates 19.10.2023: Ergänzung weiterer bemerkenswerter Quellen: SMC-Media-Briefing zum Twitter-Exodus vom 17.10.2023
Quelle: Denkangebot-Podcast